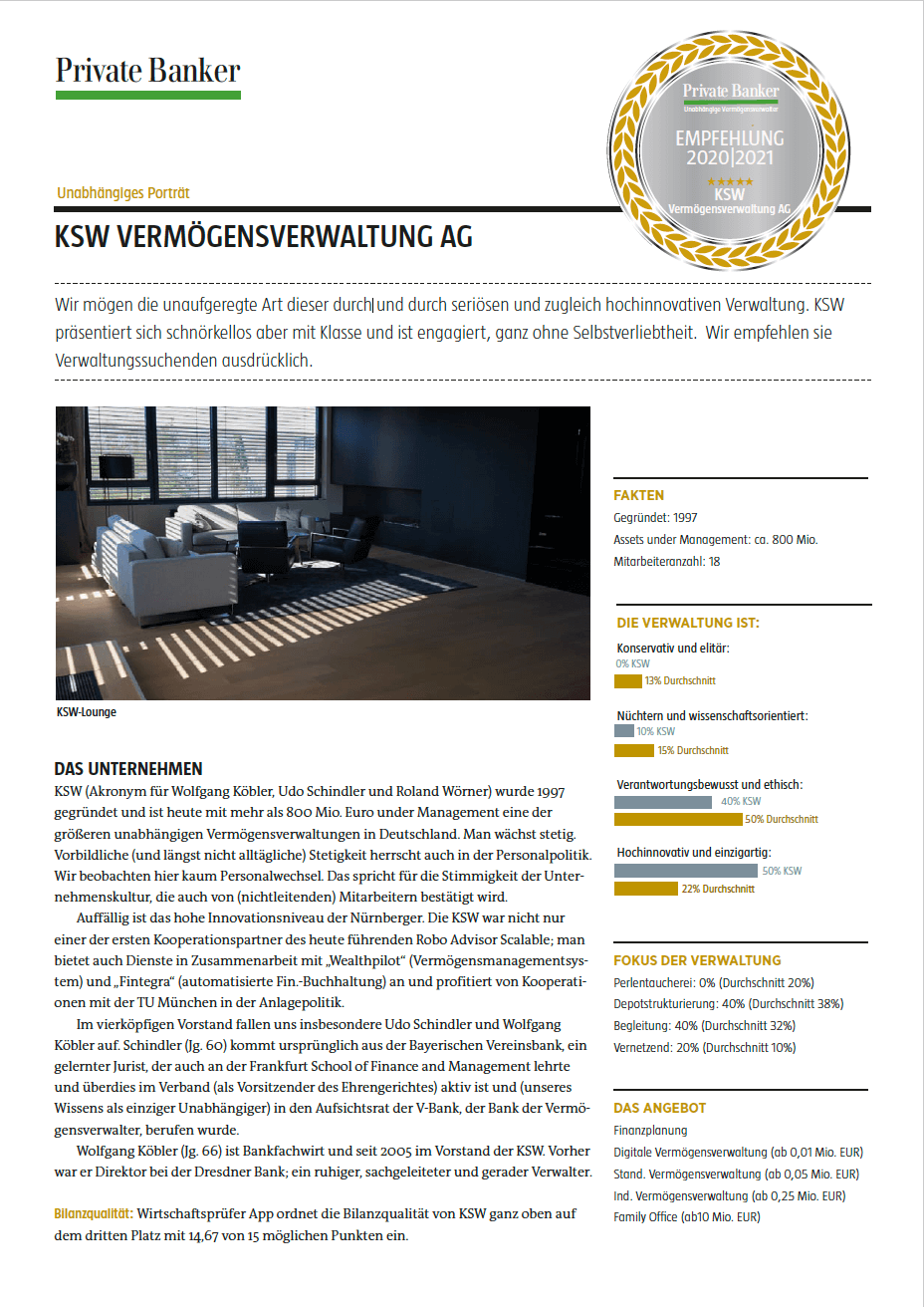Indien nutzt Impulse aus der Corona-Krise
Indien nutzt Impulse aus der Corona-Krise
Indien geriet durch Corona in eine tiefe Rezession. Nicht einmal in den Jahren der Finanzmarktkrise 2008/2009 war das der Fall.
Im Frühjahr 2020 verfügte die indische Regierung einen der strengsten Lockdowns weltweit. Das war unbedingt notwendig, denn der Virus hatte sich in dem Land extrem schnell verbreitet, und das marode Gesundheitssystem war in kürzester Zeit überfordert. Es brach Chaos in dem Land aus. Indien verzeichnet bis heute mit ca. 11 Mio. die zweithöchste Zahl von Corona Fällen weltweit, hinter den USA. Während andere Länder Hilfspakete schnürten, setzte die Regierung um Narendra Modi auf Reformen, zum Beispiel die Deregulierung der Landwirtschaft, was zu zusätzlichen Problemen führte.
Folge: Die Wirtschaft brach im 2. Quartal 2020 um 24 Prozent ein – die erste Rezession seit der Liberalisierung des Landes im Jahre 1991. Im 3. Quartal schwächte sich die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahr noch um ca. sieben Prozent ab, auch für das Gesamtjahr 2020 stand schließlich ein Minus von sieben Prozent zu Buche.
Staat baut Verkehrswege und Gesundheitssystem aus.
Der heftige wirtschaftliche Einbruch hat die indische Führung offenbar wachgerüttelt: Jetzt verdoppelt die Regierung das Haushaltsdefizit im Vergleich zum Vorjahr, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Ein erheblicher Teil der Staatsausgaben – gut 60 Mrd. Euro – gehen in Infrastrukturprojekte, wie den Ausbau des Straßennetzes (über 11.000 km zusätzlich), Stadtbahnprojekte und die digitale Infrastruktur.
Außerdem will Indien das Gesundheitssystem extrem ausbauen. Hierfür sollen 25 Mrd. Euro aufgewendet werden. Allein für die breit angelegte Impfkampagne werden gut 4 Mrd. Euro veranschlagt. Die Impfung ist in Indien sehr gut angelaufen, und an Nachschub sollte es auch nicht mangeln. Der weltweit größte Impfstoffhersteller, „Serum Institute of India“, produziert die von Astra-Zeneca entwickelte Variante für den heimischen Markt. Mit Covaxin von Bharat Biotech gibt es ein weiteres zugelassenes Präparat, das den ambitionierten Impfplan umzusetzen hilft. Bis Sommer versprach Modi, ein Drittel der Bevölkerung immunisiert zu haben. Außerdem will der Regierungschef die bisher fehlende Krankenversicherung für das Land aufbauen, um die Bevölkerung für die Zukunft besser zu schützen.
Fokus auf mehr Export.
Mit „Atmanirbhar Bharat“, was etwa „autarkes Indien“ bedeutet, nutzt die Regierung den durch Corona bereits begonnenen Trend, die Importe zu reduzieren und Exporte zu forcieren. Dazu wurden die Importzölle deutlich angehoben und exportorientierte Unternehmen subventioniert. Ziel ist es die Import-Abhängigkeit von anderen Ländern, vor allem vom Rivalen China, und somit auch das Handelsbilanzdefizit zu reduzieren. Bisher kamen fast 70 Prozent der Warenimporte aus China.
Ausländische Firmen stocken weiter Ihre Investitionen in Indien auf. Ausgerechnet im vergangenen Jahr wurden gut 40 Mrd. Dollar in Indien investiert. Das sind ca. 15 Prozent mehr als 2019. Die Firmen begründen dies mit anhaltend positiven Aussichten der indischen Wirtschaft und der qualifizierten Arbeitskräfte vor allem im IT-Sektor. Zu den Investoren gehören auch deutsche Firmen, wie SAP, T-Systems und Volkswagen. Dem Lockdown geschuldet, haben auch viele Unternehmen einen Digitalisierungsschub erlebt, was die Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert hat.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet für das aktuelle Fiskaljahr ein Wirtschaftswachstum von elf Prozent. Die Voraussetzungen sind vorhanden, um dieses große Land wieder dauerhaft in die „Wachstumsspur“ zurückzubringen. Der Indische Aktienmarkt hat bereits gezeigt was möglich ist. Trotz der Unwägbarkeiten im vergangenen Jahr konnte der indische Aktienindex Sensex ca. 15 Prozent und in diesem Jahr ca. fünf Prozent in Landeswährung zulegen. Eine attraktive Investition zur Ergänzung anderer Schwellenländer.
Über den Autor

Jörg Horneber kann auf eine klassische mehr als 25-jährige Bankkarriere zurückblicken. Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank AG im Privatkundengeschäft und einem berufsbegleitenden Studium bei der Bankakademie, übernahm er die Position als Berater im Private Banking der Deutschen Bank AG Nordbayern bis Ende 2005. Darauffolgend als Relationship Manager bei der Commerzbank AG Private Wealth Management. Den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit bildete immer die ganzheitliche Betreuung seiner Kunden.Seit April 2012 verstärkt er das Team der KSW Vermögensverwaltung AG als Portfoliomanager. In dieser Funktion ist er mit der individuellen Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten betraut.
Zollabkommen mit Großbritannien – Ruhe vor dem nächsten Sturm?
Zollabkommen mit Großbritannien – Ruhe vor dem nächsten Sturm?
Praktisch in letzter Sekunde haben sich Großbritannien und die EU auf ein Zoll- und Handelsabkommen geeinigt. Das Freihandelsabkommen steht. Doch wie steht es künftig um die Freizügigkeit – sowohl für Reisende wie auch für die britischen Akteure auf dem europäischen Finanzmarkt?
Rund 2000 Seiten stark ist das Freihandelsabkommen zwischen den Briten und der EU geworden. Es werden also keine Zölle erhoben, aber EU-Standards berücksichtigt werden. Dafür erschweren künftig andere Hindernisse den Handel. Im alltäglichen Warenaustausch muss eine Unmenge an Dokumenten erledigt werden. Ersten Schätzungen zufolge benötigt England dafür 50.000 Zollbeamte – die natürlich derzeit gar nicht vorhanden sind. Die Kosten für den zusätzlichen Bürokratieaufwand werden mit 13 Mrd. Pfund beziffert. Das alles kommt zur Unzeit: Großbritannien steckt in einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem 2. Weltkrieg. Das Bruttosozialprodukt fiel im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent, wohl auch mit bedingt durch das anfangs miserable Management der Corona Krise. Das Vereinigte Königreich ist seit dem Brexit-Referendum 2016 von Platz fünf auf Platz sieben der wichtigsten Handelspartner Deutschlands gerutscht und wurde sogar von Polen überholt.
Johnson lässt sich feiern.
Dennoch feiert sich der populistische Premier Boris Johnson und preist das Abkommen als einen Meilenstein an. Doch es ist und bleibt ein harter Brexit. England wird jetzt nicht mehr am Binnenmarkt und in der Zollunion sein. Das besonders Schmerzhafte wird allerdings erst langsam den Menschen auf der Insel klar: Es endet die Freizügigkeit der EU-Bürger. Sogar der Starmusiker Elton John hat mittlerweile auf die Situation in der Musikbranche hingewiesen, die durch den Brexit und die kommende Visumspflicht eine Hürde für internationale Konzerttourneen darstellt.
Die kritischen Nachverhandlungen folgen noch.
Das größte monetäre Problem dieses Abkommens, das so viele Jahre verhandelt wurde und doch überstürzt wirkt, wird sich in der britischen Wirtschaft bald bemerkbar machen. Die traditionell starke Dienstleistungswirtschaft macht rund 80 Prozent des britischen Bruttosozialprodukts aus – und kommt dennoch in diesem Deal kaum vor. So verlieren beispielsweise britische Finanzunternehmen den automatischen Zugang zum EU-Markt. Hier will man bis Ende März noch nachverhandeln, und darin steckt neuer Sprengstoff.
Im Warenaustausch zwischen den Ländern werden der Wegfall der europäischen CE-Kennzeichnungspflicht auf britischen Produkten und die Berücksichtigung der neuen UKCA-Kennzeichnungspflicht zu Schwierigkeiten führen. Das wird bei den Lieferketten quer durch Europa zu Verwirrung und Hindernissen führen. Die Produktionsstätten in England brauchen Zulieferteile vom europäischen Festland.
Das nächste Problem wartet mit Schottland.
Die größten Gegner des Brexits waren bekanntermaßen die Schotten. Deren Referendum zum Austritt aus dem Königreich entschieden 2014 die Befürworter des Verbleibs knapp für sich. Die berechtigte Kritik der Schotten wird sich vorerst darauf konzentrieren, dass Nordirland weiter im Binnenmarkt verbleiben wird, Schottland diese Möglichkeit aber genommen wurde. Die schottische Nationalpartei strebt bereits ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum an. Premier Johnson wird dem niemals seine Zustimmung erteilen – und daher wohl andere Zugeständnisse leisten müssen.
Die Kapitalmärkte bleiben in einer Wartestellung und konzentrieren sich derzeit eher auf die Beherrschung der Corona-Pandemie – das wird sich aber ändern, sobald die Krise abflaut. Es bleibt abzuwarten, wie dann die Märkte reagieren. Zum Feiern gibt es noch keinen Grund – ungeachtet der Tatsache, dass man mit britischen Aktien gemessen am FTSE 100 in den vergangenen 20 Jahren kein Geld verdienen konnte.
Über den Autor

Wolfgang Köbler kann auf eine klassische mehr als 35-jährige Karriere in der Finanzbranche zurückblicken. Nach verschiedenen Führungsaufgaben im Privatkundengeschäft war er zuletzt als Direktor im Wealth Management der Dresdner Bank AG tätig. Berufsbegleitend studierte er in den 80’iger Jahren an der Bankakademie und ist heute noch ehrenamtlich im Prüfungswesen der IHK tätig. Den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit bildete immer die ganzheitliche Betreuung seiner Kunden. Seit 2005 ist Wolfgang Köbler Partner und Vorstand der KSW Vermögensverwaltung AG in Nürnberg. Neben dem Management eines Family Office widmet er sich der individuellen Betreuung von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten. Nebenberuflich fungiert er als Aufsichtsratsmitglied einer börsennotierten Gesellschaft und Finanzvorstand für eine kirchliche Institution.
Grünes Licht für grünen Wasserstoff
Grünes Licht für grünen Wasserstoff
Die viel beschworene Energiewende soll eine saubere, aber zugleich sichere und bezahlbare Energieversorgung herbeiführen. Ist Wasserstoff dafür der richtige Energieträger?
Mitte 2020 sind zumindest von politischer Seite die Weichen für einen kräftigen Ausbau des Wasserstoffanteils im deutschen Energiemix gestellt worden. Die Regierungskoalition einigte sich auf ein 7 Mrd. € schweres Paket. On Top kommen nochmals 2 Mrd. € für den Aufbau von Partnerschaften mit H2 (Wasserstoff) -exportierenden Ländern.
Die Zielrichtung wurde klar formuliert. Der Wirtschaftsstandort Deutschland soll sich durch das Paket frühzeitig in der Erzeugung, Lagerung, Transport und Verwendung von klimaneutralem Wasserstoff positionieren. Durch den zusätzlich geschaffenen Wasserstoffrat werden auch die rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen geschaffen. Dadurch wird Deutschland eine führende Markposition in dem global sehr wichtigen Wasserstoffmarkt einnehmen. Wasserstoff bekommt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung und Vollendung der Energiewende.
Grau, blau, grün – eine kleine H2-Farbenlehre
Sehr wichtig bei der nationalen Wasserstoffstrategie ist dessen „Farbe“. Gefördert wird ausschließlich CO2 neutraler Wasserstoff. Also grüner und in einer Übergangsphase auch blauer Wasserstoff.
Das grün gewonnene Gas ist eine nachhaltige Alternative zu Benzin, Diesel, Kerosin oder Schweröl. Es wird z.B. durch Elektrolyse erzeugt. Hierbei wird Wasser unter Strom gesetzt und spaltet sich dadurch in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Wird der Prozess nun ausschließlich mit grüner Energie durchgeführt, dann handelt es sich auch um „grünen Wasserstoff“.
Co2-neutral ist ebenso der „blaue Wasserstoff“, welcher zwar aus Erdgas gewonnen wird. Das dabei entstehende Kohlendioxid wird allerdings nicht an die Umwelt abgegeben, sondern aufgefangen und in unterirdischen Gesteinsschichten gelagert (z.B. in leeren Ölfeldern in Norwegen).
„Grauer Wasserstoff“ hingegen heißt so, weil das bei der Produktion entstehende CO2 in die Luft abgegeben wird.
Durch thermische Spaltung von Methan wird „türkiser Wasserstoff“ hergestellt, es entsteht hierbei fester Kohlenstoff anstelle von CO2.
Die Vorteile von H2 liegen auf der Hand. Es ist ein vielfältig einsetzbarer Energieträger. Er kann z.B. in Brennstoffzellen die CO2-neutrale Mobilität befördern und auch als Basis für synthetische Kraft und Brennstoffe genutzt werden. Der vielversprechendste Ansatz in der Mobilität bezieht sich im ersten Schritt auf große Langstreckenfahrzeuge, auf Lkw, Bus, Flugzeug, Bahn.
Ebenso dient Wasserstoff als Energiespeicher, der flexibel das zeitweise Überangebot von Strom aus erneuerbaren Energien speichern kann.
Bei vielen industriellen und chemischen Anwendungen ist Wasserstoff bereits heute unverzichtbar. So wird er z.B. als Grundstoff für die Herstellung von Ammoniak benötigt. Schnell umsetzbar wäre der Einsatz CO2-neutralen Wasserstoffes in der Primärstahlindustrie . Hier würde das Gas das Steinkohlekoks ersetzen und somit den Produktionsprozess der Stahlindustrie schlagartig dekarbonisieren.
Speicher wären vorhanden
Voraussetzung für den nachhaltigen und klimaneutralen Einsatz von Wasserstoff ist ein Ausbau der erneuerbaren Energien. Ebenso müssen Lagermöglichkeiten geschaffen werden. Als eine Möglichkeit sieht man hier unterirdischen Kavernen bzw. alten Salzstöcke.
Auch eine Verteilung über weite Strecken sieht man offensichtlich als Speichermöglichkeit.
So hat Bayern eine Kooperation mit Russland in der landeseigenen Wasserstoffstrategie im Blick. Russland hat große Potentiale in Onshore-Windenergie. Somit kann die Lieferung von günstigem „grünem Wasserstoff“ in beliebiger Menge für die Nord Stream Gaspipeline sichergestellt werden.
Wir befinden uns am Anfang einer wichtigen Entwicklung in der Nutzung der H2-Technologie. Auch durch die politischen Entscheidungen kommt Dynamik in das Thema. Neben Deutschland haben sich auch die EU und China klare Ziele im Wasserstoffmarkt gesetzt. Namhafte Industrie- und Erdöl unternehmen bündeln ihr Knowhow in Joint Ventures. Eine sehr positive Entwicklung für unsere Umwelt und die weltweite Ökonomie.
Über den Autor

Jörg Horneber kann auf eine klassische mehr als 25-jährige Bankkarriere zurückblicken. Nach einer Ausbildung bei der Deutschen Bank AG im Privatkundengeschäft und einem berufsbegleitenden Studium bei der Bankakademie, übernahm er die Position als Berater im Private Banking der Deutschen Bank AG Nordbayern bis Ende 2005. Darauffolgend als Relationship Manager bei der Commerzbank AG Private Wealth Management. Den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit bildete immer die ganzheitliche Betreuung seiner Kunden.Seit April 2012 verstärkt er das Team der KSW Vermögensverwaltung AG als Portfoliomanager. In dieser Funktion ist er mit der individuellen Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten betraut.
Die Reichen der Mitte
Die Reichen der Mitte
Unter Chinas Führung entsteht gerade im asiatisch-pazifischen Raum die größte Freihandelszone der Welt. Das Land macht damit einen weiteren Schritt hin zur Spitze in der Weltwirtschaft. Währenddessen stehen die USA und die EU quasi am Spielfeldrand und dürfen nur zuschauen.
Acht Jahre zäher Verhandlungen brauchte es, bis der chinesische Staatspräsident Xi Jinping das Abkommen zur Errichtung der größten Freihandelszone der Welt (RCEP) unterzeichnen konnte. Gerade noch rechtzeitig, bevor im nächsten Jahr die großen Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der kommunistischen Partei begangen werden, untermauerte Xi damit, dass China auf dem Weg zur Nummer 1 der Weltwirtschaft nun endgültig nicht mehr zu stoppen sein dürfte.
Damit schließt sich ein Drittel der Weltbevölkerung zusammen, senkt die Handelszölle und baut bürokratische Hürden ab, um den ohnehin schon florierenden Waren- und Dienstleistungs-Austausch untereinander weiter zu beflügeln.
Trumps kleingeistige „America First“ Politik, einhergehend mit diversen Handelsstreitigkeiten, hat dieser Entwicklung Vorschub geleistet. Die noch unter Präsident Obama ausgehandelte Transpazifische Partnerschaft (TPP), die den Einfluss der USA in der Wachstumsregion Asien-Pazifik stärken sollte, liegt nach Trumps Aufkündigung gefühlt in unerreichbarer Ferne. Und bis der gewählte US-Präsident Joe Biden die Trumpschen Scherben aufgekehrt hat, dürfte der neue asiatisch-pazifische Wirtschafts-Dampfer schon ordentlich Seemeilen zurückgelegt haben.
Corona-Pandemie verschiebt das Kräfte-Verhältnis zugunsten Chinas
Natürlich könnte man gegenhalten, indem man auf den beachtlichen Anteil der USA (ca. 15,9 Prozent) und der Europäischen Union (ca. 15,4 Prozent) am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2019 verweist. Aber das ist leider der Blick in den Rückspiegel. Und der offenbart auch, dass Chinas Ausgangsbasis mit einem Anteil von ca. 17,4 Prozent ohnehin schon als hervorragend zu bezeichnen ist. Das Jahr 2020 wird die Verhältnisse noch weiter zu Gunsten des Reichs der Mitte verschieben. China wird im Gegensatz zur „westlichen Welt“ auch in Corona-Zeiten ein Wachstum erzielen, während sowohl die USA als auch die EU mit dem größten Wirtschaftseinbruch seit dem 2. Weltkrieg zu kämpfen haben.
Das stärkere Bevölkerungswachstum generell wie auch die Zunahme der kaufkräftigen Mittelschicht im Besonderen sprechen ebenfalls dafür, dass sich die Wirtschaft in Asien auch mittel- und langfristig dynamischer entwickeln wird als in Europa und den USA.
Die EU sollte den Schulterschluss mit China suchen
Müssen wir nun Angst haben vor dem neuen Wirtschafts-Koloss, der mit 2,2 Mrd. Menschen schon heute ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung erbringt? Ich denke, man sollte eher den Schulterschluss suchen, auch wenn sich das Verhältnis der EU zu den USA unter Präsident Biden wieder bessern dürfte. Eines nämlich hat die westliche Staatengemeinschaft, die so sehr auf Exporte angewiesen ist, bis heute nicht erreicht: ein umfassendes Freihandelsabkommen. Die EU muss erwachsener und emanzipierter werden und sollte sich dieser boomenden Region nicht verschließen, sondern eher stärker zuwenden.
Der Multilateralismus und die Globalisierung haben ein neues Zuhause gefunden. Und so werden aus dem Reich der Mitte eher früher als später die „Reichen der Mitte“. Das Gute ist: als Anleger muss man nicht tatenlos zuschauen, wie uns die Felle wegzuschwimmen drohen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, als Investor an der Wachstumsdynamik der RCEP-Gemeinschaft zu partizipieren.
Über den Autor

Seit mehr als 30 Jahren fühlt sich Udo Rieder dem Wertpapiergeschäft verbunden. Der Ausbildung bei der Deutschen Bank AG in Nürnberg folgten Einsätze als Investmentmanager in Lübeck und Genf, wo er das internationale Geschäft sehr wohlhabender Klienten betreute. Seine Rückkehr nach Deutschland führte ihn über die Leitung der Vermögensverwaltung für Nordbayern hin zur Verantwortung für die Investmentmanager im neu gegründeten Geschäftsbereich Private Wealth Management. Im Jahr 2008 ist er zur UBS Deutschland AG gewechselt, um die neu zu eröffnende Niederlassung Nürnberg mit aufzubauen. Seine berufliche Tätigkeit wurde flankiert von berufsbegleitenden Studien an der Bankakademie und der European Business School. Zudem ist er zertifizierter Eurex-Anlageberater. Im Januar 2015 trat Herr Rieder als Gesellschafter der KSW bei, um seine Kunden als Portfoliomanager weiterhin individuell zu betreuen.
KSW erhält 2021 höchste Auszeichnung „summa cum laude“ bei Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum
KSW erhält 2021 höchste Auszeichnung „summa cum laude“ bei Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum

Die KSW Vermögensverwaltung bekommt mit dem Prädikat „summa cum laude“ vom Handelsblatt und dem Fachmagazin „Elite Report“ die höchste Auszeichnung und ist jetzt in der obersten Kategorie der Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum angekommen. Am 25.11.2020 erfolgte die Auszeichnung Corona-bedingt im Rahmen eines Livestreams. Insgesamt wurden 34 Vermögensverwalter und Banken von den insgesamt 350 untersuchten Anbietern in der höchsten Kategorie „summa cum laude“ ausgezeichnet.
„Hier ist die Zukunft zum Greifen nahe“, so beschreibt der Herausgeber des „Elite Reports“, Kaspar von Schönfels, in seinem persönlichen Kommentar die KSW. Neben dem überaus erfolgreichen Portfoliomanagement mit wissenschaftlichem Ansatz wurde vor allem die Finanzplanung für die anspruchsvolle und vermögende Kundschaft lobend herausgestellt: „Hier hat man den Kunden verstanden“. Bei dem Branchenvorreiter findet Nachhaltigkeit nicht nur beim Investieren statt, sondern wird durch ein energieeffizientes Bürogebäude, Elektrofuhrpark und nachhaltigem Rohstoffverbrauch täglich gelebt. Nicht nur Vermögensinhaber aus der Frankenregion wählen nun den Weg zu diesem Haus, sondern auch viele Stiftungen. Und das schon seit Jahrzehnten.
Livestream der Prädikatsverleihung „summa cum laude“:
Deutschland sollte sich einen Staatsfonds leisten
Deutschland sollte sich einen Staatsfonds leisten
Norwegen und viele weitere Länder der Welt haben den Wohlstand ihrer Bevölkerung über eigene Staatsfonds abgesichert. Auch in Deutschland wären die Mittel dazu vorhanden.
Norwegen hat 1990 auf der Grundlage seines Ölreichtums einen Staatsfonds geschaffen, der dem Land zu Wohlstand und einem der höchsten Lebensstandards weltweit verholfen hat. Der skandinavische Staat war sich vor 30 Jahren einig, dass die ehemals großen Ölreserven irgendwann einmal zu Ende gehen. Die Einnahmen daraus sollten aber auch den kommenden Generationen zu Gute kommen.
Andere Staaten haben ebenfalls Staatsfonds errichtet, Kuwait zum Beispiel schon 1953. Die Schweiz hat quasi durch die Geldpolitik der nationalen Notenbank dafür gesorgt, dass in den zurückliegenden fünf Jahren ein erhebliches Auslandsvermögen entstanden ist, welches rechnerisch allen Schweizer Bürgern zusteht. Mittlerweile gibt es rund 80 Staatsfonds auf der Welt, die bei der Mittelverwendung jeweils unterschiedlich ausgerichtet sind. Die drei größten Fonds sind der norwegische, gefolgt vom chinesischen und dem der Arabischen Emirate. In Deutschland existiert so ein Staatsfonds bisher nicht, obwohl wir über genügend ökonomische Ressourcen verfügen, ein ähnliches Konstrukt für uns und die folgenden Generationen zu schaffen.
Norwegen hat es vorgemacht
Die Vorteile eines solchen Sondervermögens haben sich in der Corona Krise im zweiten Quartal 2020 gezeigt. Norwegen konnte liquide Mittel zur Bewältigung der Krise aus den laufenden Überschüssen entnehmen. Wir in Deutschland müssen hingegen neue Schulden aufnehmen, obwohl auch wir Möglichkeiten hätten, staatliches Eigentum dafür einzusetzen.
Target-2-Forderungen als Basis
Einer der führenden Volkswirte Deutschlands, Dr. Daniel Stelter, hat vor einigen Wochen die Idee in den Raum geworfen, unsere Target-2-Salden, die statistisch gesehen zum Auslandsvermögen der deutschen Bevölkerung zählen, als Anfangsguthaben in einen solchen Fonds zu investieren. Bei den Target-Forderungen handelt es sich um Positionen im internen europäischen Verrechnungssystem zwischen den nationalen Notenbanken. Mittlerweile haben sie knapp 1 Billion Euro zu Gunsten der deutschen Bundesbank erreicht. Theoretisch könnte die Bundesbank die Target-2-Forderungen gegenüber anderen nationalen europäischen Notenbanken an eine ausländische Bank abtreten. Daraus ließe sich das Anfangsvermögen für einen deutschen Staatsfonds schaffen. Damit wären die Target-2-Salden reduziert und zugleich die Basis für sinnvolles Investieren geschaffen. Als Alternative wird in den Medien die Auflage nahezu unverzinster deutscher Staatsanleihen diskutiert.
Politiker fordern bereits eindringlich einen Fonds
Die Schaffung eines eigenen deutschen Staatsfonds wird mittlerweile sogar von einigen Politikern gefordert. Als Vorbild gilt der norwegische Staatsfonds, der politisch völlig unabhängig agiert. Eine Ethikkommission überwacht lediglich die Einhaltung sozialer, ethischer und ökologischer Richtlinien. So dürfen die Gelder ausschließlich im Ausland investiert werden, um so die Wertsteigerung des Fondsvermögens unabhängig von den Schwankungen der Binnenvolkswirtschaft zu machen. Maßgeblich ist jedoch, die regierungsunabhängige Verwaltung des Fonds, die eine nachhaltige Allokation ermöglicht und das Vermögen vor kurzfristigen politisch motivierten Entnahmen bewahrt. So darf die norwegische Regierung höchstens vier Prozent des Fondsvermögens für den jährlichen Staatshaushalt verwenden.
Deutschland hat bereits 2017 einen „Atomfonds“ gegründet
Dass Deutschland in der Lage, ist ein solches Sondervermögen zu schaffen, zeigt der 2017 aufgelegte Fonds zur Bewältigung der Kosten aus dem Atomausstieg. Dieser wurden von den großen Energieversorgern unter Mitwirkung des Staates mit 24 Mrd. Euro Anfangskapital gegründet und soll bis zum Jahr 2100 auf ca. 169 Mrd. Euro anwachsen.
Fazit
Ein deutscher Staatsfonds würde es ermöglichen, den Wandel unserer Volkswirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben und einen maßgeblichen Beitrag auch zur Erfüllung des europäischen Klimapaktes zu leisten. Darüberhinaus ist die Idee von Stelter intensiv zu diskutieren, sich dem Problem der Target-2-Salden zu widmen.
Über den Autor

Wolfgang Köbler kann auf eine klassische mehr als 35-jährige Karriere in der Finanzbranche zurückblicken. Nach verschiedenen Führungsaufgaben im Privatkundengeschäft war er zuletzt als Direktor im Wealth Management der Dresdner Bank AG tätig. Berufsbegleitend studierte er in den 80’iger Jahren an der Bankakademie und ist heute noch ehrenamtlich im Prüfungswesen der IHK tätig. Den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit bildete immer die ganzheitliche Betreuung seiner Kunden. Seit 2005 ist Wolfgang Köbler Partner und Vorstand der KSW Vermögensverwaltung AG in Nürnberg. Neben dem Management eines Family Office widmet er sich der individuellen Betreuung von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten. Nebenberuflich fungiert er als Aufsichtsratsmitglied einer börsennotierten Gesellschaft und Finanzvorstand für eine kirchliche Institution.
Die Technologie-Party geht weiter
Die Technologie-Party geht weiter
Die Kurse von Technologiewerten entfernen sich immer mehr von herkömmlichen Bewertungsmaßstäben. Für Anleger bedeutet dies, dass sie selektiver vorgehen und Unternehmens-Stories kritisch hinterfragen müssen. Dennoch gehören Aktien weiterhin ins Depot. Denn die globale Geldschwemme wird die Vermögenspreise weiter steigen lassen.
Über 90 % aller Staaten stecken in einer Rezession, ihre Schuldenquoten schießen in die Höhe. Allein in den vergangenen Monaten nahmen die Länder weltweit neue Kredite im Umfang von rund 10 Billionen US-Dollar auf. Das Risiko, dass einige Staaten ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen (können), wird von den Kapitalmärkten derzeit komplett ausgeblendet.
Die Kaufprogramme der Notenbanken werden von den Anlegern als Garantie für „nie wieder fallende Kurse“ bei Anleihen und somit als ewige Null-Zins Situation hingenommen, worauf sich viele Anlagestrategien im Anleihesegment begründen. Dividenden von Aktien wurden zwischenzeitlich als neue Zinsen gefeiert, doch auch dieses Thema zieht nicht mehr. Dividenden will niemand mehr haben, Technologie ist das aktuelle Zauberwort am Anlagehimmel. Der teilweise kometenhafte Kursanstieg einiger Aktien hinterlässt sowohl jubelnde als auch ungläubige Anleger.
Fortschritt gewinnt an Dynamik
Die Bewertungen großer Technologiewerte erinnern an die Sorglosigkeit zu Zeiten der Internetblase vor 20 Jahren. Auch damals zählten phantastische „Stories“ mehr als Substanz und Ertrag des jeweiligen Unternehmens. Doch die damaligen Verhältnisse sind nur schwer mit der aktuellen Situation vergleichbar. Zum einen gab es zu jener Zeit noch Zinsen. Zum anderen hat der Druck zugenommen, neue Technologien schneller (weiter) zu entwickeln. Diese Dynamik hat sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie beschleunigt.
Trotzdem darf man sich zum Beispiel die Frage stellen, ob ein Unternehmen wie Tesla an der Börse dauerhaft mehr wert sein kann, als die beiden größten Automobilhersteller der Welt zusammen, Volkswagen und Toyota. Daneben werden auch viele Gesellschaften nur mit finanzieller Hilfe am Leben gehalten. Man spricht dabei von sogenannten Zombie-Unternehmen. Allein in Deutschland schätzt man ihre Zahl derzeit auf über 500.000, Tendenz steigend. Sobald die von der Politik initiierte Flut monetärer Hilfspakete der nächsten Schuldendiskussion weichen muss, wird sich schnell zeigen, wer ohne Badehose gebadet hat.
Auf Mix aus Trendsettern und Substanzwerten setzen
In der aktuellen Situation, die sich möglicherweise nicht so schnell ändert, besteht die Kunst darin, mit dem richtigen Portfolio-Mix weiterhin an dynamischen Entwicklungen zu partizipieren, aber auch nicht gleich komplett nach unten durchgereicht zu werden, wenn an der Börse möglicherweise Ernüchterung eintritt. Das wird nur mit einer durchdachten Mischung aus Trendsettern am Aktienmarkt einerseits, wie auch defensiven, vernachlässigten und substanzstarken Titeln andererseits halbwegs zu stemmen sein. Bei den Trendwerten ist die Konzentration auf Bereiche festzustellen, in denen der Wandel besonders erkennbar ist und damit strukturelles Wachstum erzielt wird. Hier wäre zum Beispiel die Digitalisierung in der Arbeitswelt, der Bildung und im Einkaufsverhalten hervorzuheben. Da sind schon mal jüngere Unternehmen mit auf die Watchliste zu nehmen, die erst in der Zukunft Geld verdienen werden.
Substanzielle Titel aus der Tech-Branche sind vor allem in den USA zu finden, Konzerne wie Adobe, Alphabet, Apple oder Microsoft sind seit Jahren erfolgreich und schwimmen in Geld. Auch wenn diese Werte analytisch gesehen nicht gerade günstig sind, es wird auf längere Sicht weiter aufwärts gehen (müssen).
Da die Korrelation der Rententitel zum Aktienmarkt, als auch die eingangs erwähnte Null- oder Negativverzinsung schon länger keine Absicherung in schwierigen Zeiten mehr bieten kann, dürfen alternative Investments als Vermögensbausteine und Aufbewahrungsmittel für den Geldwerterhalt keinesfalls fehlen.
Auf bessere Zeiten zu warten lohnt nicht, denn die enorme Geldschöpfung wird weiterhin den Anstieg der Vermögenspreise befeuern. Als Investor ist eine gehörige Portion Mut sicherlich angebracht. Blindlings mit der Herde zu laufen, dürfte sich jedoch auch diesmal eher als grob fahrlässig erweisen.
Über den Autor

Manfred Rath ist seit mehr als 35 Jahren im Vermögensanlagegeschäft tätig. Bereits nach der Ausbildung ging er den klassischen Weg zum Wertpapierspezialisten in der damaligen Bayerischen Vereinsbank. Dort übernahm er auch die Leitung eines Teams in der Nordoberpfalz, bevor er nach 27-jähriger Zugehörigkeit zur BHF BANK wechselte. In diesen 6 Jahren bei der Privatbank war der Schwerpunkt erneut die Vermögensanlage und -allokation sowie die stellvertretende Leitung der Niederlassung Nürnberg. Seit Juli 2012 ist er als Portfoliomanager für die KSW tätig.
Glänzende Alternativen?
Glänzende Alternativen?
Während der schlimmsten Tage der ersten Corona-Welle habe ich mein „Comeback“ als Kolumnist für die Zeit angekündigt, in der sich alles wieder ein wenig normalisiert hat. Angesichts der seitdem weltweit zu beobachtenden Erholungen an den Kapitalmärkten könnte man wieder an eine heile Börsenwelt glauben. Ist dem jedoch wirklich so? Oder kommt die Krise mit voller Wucht zurück und es braucht mehr krisenfeste Anlagen im Depot?
Wenn man sich mit volkswirtschaftlichen Indikatoren oder fundamentalen Kennzahlen beschäftigt, dann darf man sich schon fragen, ob all das Wissen, das man sich über Jahrzehnte angeeignet hat, aktuell „für die Katz‘“ ist. Es scheint nur noch eine Börsenregel zu gelten: Leg‘ Dich niemals mit den Notenbanken an!
Silber noch mit Luft nach oben
Zeitgleich mit den Aktienkursen ist jedoch auch der Goldpreis gestiegen. Angesichts der Höchststände, die zwischenzeitlich erreicht wurden, suchen Investoren nun vermehrt nach Alternativen zum gelben Metall. Aber gibt es überhaupt eine ähnlich krisenfeste und gleichermaßen liquide „Währung“ wie Gold?
Schnell landet man auf der Suche bei der „kleinen Schwester“ Silber, die sich in den vergangenen Jahren ähnlich entwickelt hat wie Gold, wenn auch unter höheren Schwankungen. Und im Gegensatz zum großen Bruder ist bis zu den alten Höchstständen noch reichlich Luft nach oben. Für Silber spricht neben der Nullzinspolitik der Notenbanken auch eine anziehende industrielle Nachfrage, sofern sich die Nach-Corona-Wirtschaft erholt wie erhofft. Den Silberpreis dürfte zudem stützen, dass pandemiebedingt die Förderung vor allem in den wichtigen südamerikanischen Minen gekürzt wurde.
Platin und Palladium hängen an der Autokonjunktur
Und Platin? Das edelste der Metalle hat in der Vergangenheit nicht gerade glänzen können und notiert deutlich unter seinen ehemaligen Höchstständen. Da Platin vor allem in der Automobil- und Luftfahrtindustrie nachgefragt wird, hat der Kurs unter der Viruskrise stark gelitten. Nimmt die Wirtschaft wieder Fahrt auf, bessert sich auch der Ausblick für die Preisentwicklung für Platin. Angesichts der aktuell sehr niedrigen Korrelation zum Gold erscheint das Kurspotenzial aber begrenzt.
Palladium, das nur wenige Anleger auf dem Radar haben, wird zu einem verschwindend geringen Anteil in der Schmuckindustrie verarbeitet. Über 80 % der Nachfrage kam 2019 aus der Automobilindustrie für Katalysatoren. Entsprechend verzeichnete das silberweiße Metall im Frühjahr auch den größten „Corona-Abschlag“ mit ca. 40 % vom zwischenzeitlichen Hoch. In den zurückliegenden fünf Jahren jedoch war es das mit Abstand attraktivste Edelmetall-Investment. Dennoch eignet es sich kaum als stabilisierender Bestandteil eines privaten Depots. Das geringe Handelsvolumen und die Marktenge sorgen für eine sehr hohe Volatilität.
Nicht unerwähnt will ich lassen, dass der Ausblick für einige Basis- bzw. Industriemetalle momentan recht attraktiv ist, aber es sind eben keine „alternativen Edelmetalle“. Und gerade in den unsicheren Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, hat die Überschrift einer meiner früheren Kolumnen weiterhin Bestand: „Gold und Silber lieb‘ ich sehr, kann’s auch gut gebrauchen.“
Über den Autor

Seit mehr als 30 Jahren fühlt sich Udo Rieder dem Wertpapiergeschäft verbunden. Der Ausbildung bei der Deutschen Bank AG in Nürnberg folgten Einsätze als Investmentmanager in Lübeck und Genf, wo er das internationale Geschäft sehr wohlhabender Klienten betreute. Seine Rückkehr nach Deutschland führte ihn über die Leitung der Vermögensverwaltung für Nordbayern hin zur Verantwortung für die Investmentmanager im neu gegründeten Geschäftsbereich Private Wealth Management. Im Jahr 2008 ist er zur UBS Deutschland AG gewechselt, um die neu zu eröffnende Niederlassung Nürnberg mit aufzubauen. Seine berufliche Tätigkeit wurde flankiert von berufsbegleitenden Studien an der Bankakademie und der European Business School. Zudem ist er zertifizierter Eurex-Anlageberater. Im Januar 2015 trat Herr Rieder als Gesellschafter der KSW bei, um seine Kunden als Portfoliomanager weiterhin individuell zu betreuen.
Corona-Schulden: Pandemie stellt der Politik einen "Freibrief" aus
Corona-Schulden: Pandemie stellt der Politik einen „Freibrief“ aus
Die Löcher, die der Shutdown im Zuge der Covid-19-Pandemie gerissen hat, werden mit frisch gedrucktem Geld und einem massiven Anstieg der Staatsverschuldung bezahlt – vorerst. Denn auch diese Kredite müssen Staaten begleichen, mahnt Vermögensverwalter Wolfgang Köbler.
Es scheint, als stelle die Pandemie der Politik einen Freibrief aus: Was die Regierungen jahrzehntelang versäumt haben, schieben sie jetzt auf das Coronavirus, sagt Wolfgang Köbler, Vorstand des Nürnberger Vermögensverwalters KSW.
Dabei dürfe man Politik und Notenbanken durchaus dafür loben, wie schnell sie begonnen haben, die Coronakrise zu bekämpfen und Schaden abzuwenden. Man müsse aber auch den Aufwand hinterfragen: „Nach ersten Berechnungen der Deutschen Bank könnten es 1,9 Billionen Euro werden, die zur Bewältigung der Pandemiefolgen aufgebracht werden“, erklärt der Vermögensprofi. Dies entspräche fast den Kosten der deutschen Wiedervereinigung oder dem Stand der Staatsschulden der Bundesrepublik.
Wer soll das bezahlen?
Herkömmliche Lösungsansätze werden nicht wirken, um den Schuldenberg nach Ende der Covid-19-Pandemie abzutragen. Am Ende dürften die Staaten ihre Schulden in der Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) abladen, fürchtet Köbler. Die EU bräuchte dann ein System, wie sie den Regierungen gerecht werden kann, die sparsam gewirtschaftet haben.
Wahrscheinlich wird man dem Experten zufolge aber versuchen, eine erneute Verlängerung des bisherigen Systems zu erreichen: steigende Asset-Preise, stabile Konjunktur und Wohlstand auf Pump. „Es ist daher das Gebot der Stunde, seine Vermögenszusammensetzung auf eine solche Entwicklung auszurichten“, sagt Köbler. Denn die Wahrscheinlichkeit wachse, dass Anleger noch in diesem Jahrzehnt neue staatliche Instrumente kennenlernen werden – beispielsweise Beschränkungen des Kapitalverkehrs.
Über den Autor

Wolfgang Köbler kann auf eine klassische mehr als 35-jährige Karriere in der Finanzbranche zurückblicken. Nach verschiedenen Führungsaufgaben im Privatkundengeschäft war er zuletzt als Direktor im Wealth Management der Dresdner Bank AG tätig. Berufsbegleitend studierte er in den 80’iger Jahren an der Bankakademie und ist heute noch ehrenamtlich im Prüfungswesen der IHK tätig. Den Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit bildete immer die ganzheitliche Betreuung seiner Kunden. Seit 2005 ist Wolfgang Köbler Partner und Vorstand der KSW Vermögensverwaltung AG in Nürnberg. Neben dem Management eines Family Office widmet er sich der individuellen Betreuung von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten. Nebenberuflich fungiert er als Aufsichtsratsmitglied einer börsennotierten Gesellschaft und Finanzvorstand für eine kirchliche Institution.